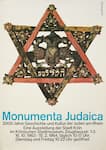Eine Ausstellung mit großer Wirkung
Jüdisches Leben und vor allem die Vertreibung und Ermordung von Millionen Jüdinnen*Juden wurden in der deutschen Öffentlichkeit nach 1945 kaum thematisiert. Den Anstoß zur Ausstellung Monumenta Judaica gaben antisemitische Schmierereien an der Fassade der kurz zuvor wieder eingeweihten Kölner Synagoge am 24. Dezember 1959. Eine öffentliche Auseinandersetzung mit dem Schicksal der Jüdinnen*Juden im Rheinland war zu diesem Zeitpunkt längst überfällig.
Die von Konrad Schilling kuratierte Ausstellung wollte den Besucher*innen jüdische Geschichte und Kultur näherbringen und die Gemeinsamkeiten mit dem Christentum aufzeigen. Gleichzeitig versuchte sie auch, die Geschichte der Vertreibung und Ermordung von Jüdinnen*Juden durch das NS-Regime zu thematisieren.
Stimmen von Zeitgenoss*innen
-
Das Erschütternste erlebte ich, als jemand auf den Fotos vom KZ seinen Vater erkannte.
Hans Heinrich Hasselmeier, Museumsmitarbeiter -
Ein junger Mann las im „Gelben Stern“ und sagte mehrmals erregt zu seinem Vater: „Schau dir das an“ Und davon wollt ihr alle nichts gewußt haben!
Aus den Aufzeichnungen der Mitarbeiter*innen -
Es geht um die Freiheit jedes Menschen, um die Achtung vor jedem Menschen und die Beachtung seiner Tradition [...]. Die Ausstellung „Monumenta Judaica“ hat eine große Chance in diesem Sinn zu wirken.
Dr. Herbert Lewin, Vorsitzender des Zentralrats der Juden in Deutschland -
Die Ausstellung will weder anklagen noch wiedergutmachen, sie will ganz einfach die Wahrheit aufdecken.
Die Welt, 19.10.1963 -
Die Stadt Köln hat […] einen großen Beitrag zur Menschlichkeit und Kultur geleistet. Vielleicht ist dies ein Akt des unruhigen Gewissens, und vielleicht teilen die vielen Tausende, die die Ausstellung besucht haben, in gewissem Maße dieses Gefühl der Schuld.
The Synagogue Review, 1964